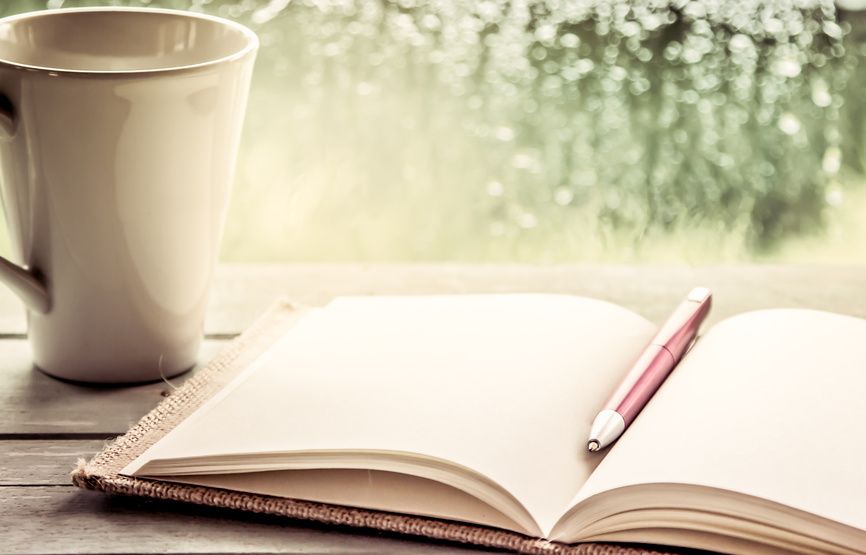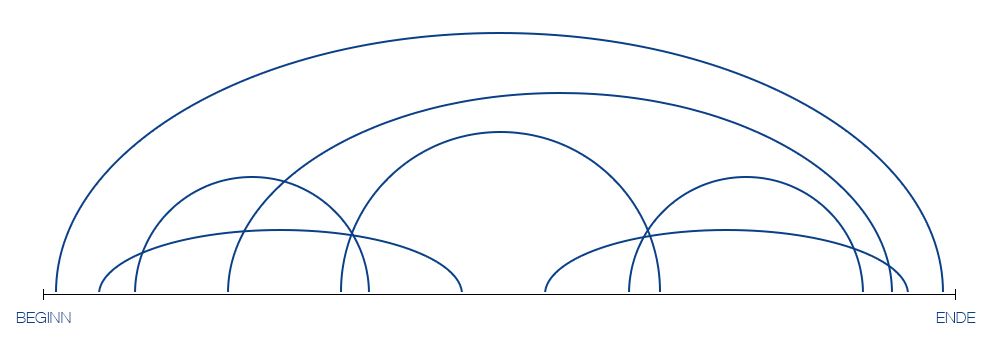Komposition der Handlung – Methoden zur Handlungsentwicklung
März 19, 2016 • von VerenaHeute startet die Serie »Komposition der Handlung«, mit der ich mich in den nächsten drei Blogposts beschäftigen werde. Im heutigen Beitrag möchte ich euch deshalb verschiedene Methoden der Handlungsentwicklung vorstellen. Im April werde ich euch etwas über kompositorische Mittel und verschiedene Plotmodelle berichten und im Mai wird es schließlich um die Möglichkeiten der Verknüpfung der Szenen gehen.
In meinem Beitrag zum Thema »Plot« hab ich euch bereits einiges zum Aufbau der Handlung erzählt. Unter anderem, dass die Suche nach der Antwort auf die zentrale dramatische Frage den Leser durch die Handlung führt und dass Ziele und Konflikte die Figuren in Bewegung halten. Auch wie Anfang, Mitte und Ende gestaltet sein sollten, habe ich in dem Beitrag berichtet. Wenn es jedoch darum geht, eine Geschichte zu schreiben, die logisch aufgebaut und in sich geschlossen ist, kann es hilfreich sein, eine Handlung zu entwickeln. Die Planung der Handlung hatte ich am Ende meines Plot-Beitrags bereits kurz angeschnitten. Heute möchte ich hierzu etwas mehr ins Detail gehen.
Was bedeutet »Komposition der Handlung«?
Der Begriff »Komposition« wird gebraucht, um zu beschreiben, wie ein Autor seine Geschichte aufgebaut hat. Er wird vor allem in der Epik verwendet. Autoren haben für den Aufbau bzw. die Planung der Handlung verschiedene Möglichkeiten und Methoden zur Auswahl – einige davon möchte ich euch hier vorstellen.
1. Die Snowflake-Methode
Die Snowflake-Methode wurde vom Autor Randy Ingermanson erfunden. Die Methode heißt so, da die Technik an das Aussehen einer Schneeflocke erinnert. So wie sich eine Schneeflocke von innen nach außen immer weiter auffächert, wird auch bei seiner Technik die Romanhandlung Stufe für Stufe immer weiter heruntergebrochen, bis sich eine komplexe, ausgereifte Romanhandlung ergibt.
Die Methode umfasst zehn Arbeitsschritte, die sich wie folgt zusammensetzen:
1) Die Geschichte wird in einem einzigen Satz zusammengefasst.
2) Nun folgt eine Zusammenfassung der Geschichte in einem Absatz mit fünf Sätzen.
3) Für jede wichtige Figur wird ein Blatt zur Hand genommen und Folgendes festgehalten: Name der Figur, Zusammenfassung »ihrer« Geschichte innerhalb der Erzählung in einem einzigen Satz, Motivation, Ziel, Konflikte und wie sie sich im Laufe der Handlung ändern wird. Nun folgt nochmals eine Zusammenfassung der Geschichte dieser Figur in einem Satz, falls sie sich im Laufe dieser Überlegungen geändert hat.
4) Die fünf Sätze aus 2) werden zu fünf Absätzen erweitert. Der ganze Text sollte jedoch nicht mehr als eine Seite umfassen.
5) Nun werden die Haupt- und Nebenfiguren im Hinblick auf ihre Biografie und Persönlichkeit beschrieben. Für die Hauptfiguren wird eine Seite veranschlagt, für die Nebenfiguren je eine halbe Seite.
6) Die Zusammenfassung aus 4) wird auf vier Seiten erweitert bzw. detaillierter ausgeführt.
7) Nun wird alles aufgeschrieben, was man über die Figuren weiß. Besonderen Wert sollte auf die Veränderung der Figur gelegt werden, die sie während der Geschichte durchmacht.
8) Jetzt wird die Zusammenfassung der Handlung erneut zur Hand genommen, um die einzelnen Szenen aufzulisten, aus denen sich die Handlung zusammensetzen wird. Hier können bereits Stichpunkte zum Inhalt der einzelnen Szenen und zur Perspektive gemacht werden.
9) Dieser Arbeitsschritt ist freiwillig. Hier kann zu jeder Szene eine Zusammenfassung geschrieben werden, mit allem, was einem zu diesem Zeitpunkt zu der Szene einfällt.
10) Nun kann endlich die erste Fassung der Geschichte niedergeschrieben werden!
Wie ihr seht, sind die verschiedenen Arbeitsschritte recht zeitintensiv. Es kann also sein, dass bis zum letzten Schritt bereits mehrere Wochen oder sogar Monate vergangen sind.
Diese Methode eignet sich übrigens nur, wenn ihr bereits die grobe Handlung und die Figuren im Kopf habt. Als Kreativtechnik zur Ideenfindung ist sie nicht geeignet.
2. Das Stufendiagramm nach Elizabeth George
Elizabeth George ist eine amerikanische Krimi-Autorin, die durch ihre Inspector-Lynley-Romane bekannt wurde. In Ihrem Schreibratgeber »Wort für Wort – oder Die Kunst, ein gutes Buch zu schreiben« verweist sie immer wieder auf das Stufendiagramm, mit dem Sie arbeitet, um die Handlung ihrer Geschichten zu planen. Sie beschreibt es als eine Liste von Szenen, die sie anlegt, bevor sie ihren Roman schreibt.
Ein Stufendiagramm ist im Grunde also nichts anderes als eine detaillierte Aufstellung der Szenen, die in der Geschichte vorkommen sollen oder könnten. Hier können bereits erste Details in Stichworten notiert werden, damit diese später nicht vergessen gehen. Manche Autoren schreiben sogar bereits sehr viele Einzelheiten hinein, andere legen ihr Stufendiagramm nur skizzenhaft und dürftig an.
Im nächsten Schritt schreibt Elizabeth George dann für jede Szene einen detaillierten Handlungsentwurf. Hierbei sammelt sie so viele Informationen über die Szene wie möglich, gibt sich selbst Anweisungen, worauf sie zu achten hat, und erarbeitet sich somit eine Vorlage, auf deren Grundlage sie schließlich die eigentliche Geschichte niederschreibt.
3. Karteikarten oder einzelne Blätter
Eine weitere Möglichkeit, die Handlung und alle möglichen Einzelheiten der Geschichte festzuhalten, sind Karteikarten oder einzelne Blätter. Der Vorteil hieran ist, dass man sie leicht hin und her schieben kann, um die richtige oder passendste Reihenfolge zu finden – denn nur mit der logischen Reihenfolge wird die Handlung später für den Leser nachvollziehbar. Außerdem kann man mit ihnen einzelne Elemente der Geschichte gesondert betrachten und Beziehungen zwischen ihnen herstellen.
Für jede Szene wird also ein Blatt oder eine Karteikarte angelegt. Hier notiert man auch das Ziel der Szene, die Erzählperspektive, das Problem, den Konflikt und eventuell auch die Gefühle und Gedanken des Protagonisten. Danach kann man die Karten oder Blätter beliebig verschieben, bis es passt, und beginnen, die Geschichte niederzuschreiben. Die Anordnung der einzelnen Szenen im Vorhinein verhindert, dass man erst nach Hunderten geschriebener Seiten bemerkt, wenn etwas mit der Handlung nicht stimmt.
Da Kreativität jedoch nicht nach Rezept funktioniert, solltet ihr euch für euren Handlungsaufbau eine eigene Methode zurechtlegen, die für euch funktioniert. Vielleicht ist es eine Mischung aus verschiedenen Methoden, vielleicht sogar eine ganz andere – denn es gibt noch tausende mehr, doch diese aufzuzeigen würde den Rahmen sprengen.
Bevor ich wusste, dass es diese verschiedenen Techniken und Methoden gibt, hatte ich mir bereits eine eigene angeeignet. Inzwischen weiß ich, dass es eine Mischung aus den oben genannten ist. Mein Medium ist dabei der PC, denn ich halte alle Ideen in Word-Dokumenten fest. Wenn ich mit einer Geschichte beginne, dann halte ich mich an einen roten Faden. Meist weiß ich dann schon, wer die Hauptperson ist, wo sie hinwill und wie die Geschichte ausgehen soll. Ich kenne den Anfang, einen Teil in der Mitte und das Ende – das ist mein roter Faden. Nur das »Dazwischen« ist mir meist noch unbekannt. Ich lege dann, wie oben beschrieben, eine Liste mit Szenen bzw. Kapiteln an und notiere mir grob den Inhalt. Danach beginne ich zu schreiben. Immer wenn mir während des Schreibprozesses etwas Neues einfällt, ein neuer Charakter oder eine Szene, die ich einbauen möchte, dann notiere ich dies ebenfalls in dem Word-Dokument mit meinem roten Faden. Ich habe festgestellt, dass dies am besten funktioniert, da ich mir so die Möglichkeit offenlasse, an der Handlung noch etwas herum zu doktern.
Wie ihr am Ende vorgehen möchtet, ist natürlich euch überlassen. Vielleicht kommt ihr besser klar, wenn ihr euch vorher alle Einzelheiten ausgedacht habt und euch beim Schreiben strikt daran haltet. Wie gesagt, jeder Autor ist anders. Wenn ihr ein wenig herumprobiert, dann findet ihr sicher bald eine Methode, die für euch funktioniert.
Nun wünsche ich euch viel Freude beim Ausprobieren der verschiedenen Methoden. Falls ihr bereits eine eigene Technik besitzt, dann schreibt mir doch, wie ihr beim Entwickeln eurer Handlung vorgeht. Ich freue mich, von euch zu hören!
Eure Verena