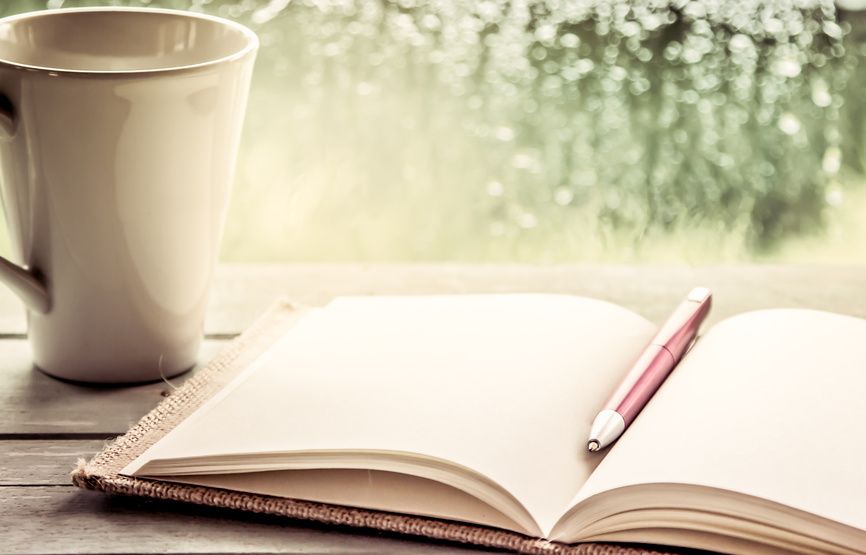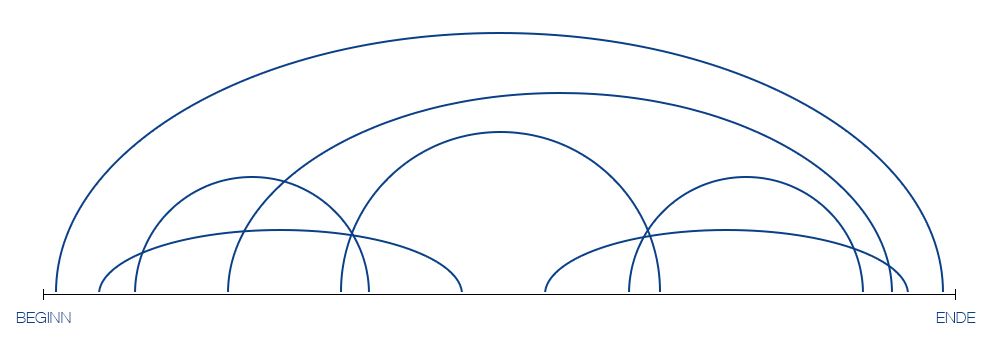Für eine Erzählung, vor allem auch für längere Geschichten, ist es sehr wichtig, die passende Erzählperspektive zu wählen. Denn nicht jede Erzählperspektive eignet sich auch für jeden Text. Aus diesem Grund stelle ich euch heute die verschiedenen Arten des Erzählens vor und zeige euch, wie ihr die passende Perspektive für eure Geschichte findet.
Bevor ich auf die verschiedenen Erzähler zu sprechen komme, möchte ich hier noch kurz auf eine häufig vorkommende Verwechslung eingehen: Der Autor und der Erzähler sind nicht das Gleiche. Oft sind die Leser versucht, Autor und Erzähler in einen Topf zu werfen. Das kommt daher, dass man als Autor die Geschichte so real wie möglich verfassen möchte und dafür einen Erzähler wählt, der diese Realität am besten vorspiegeln kann. Doch auch wenn einige Autoren autobiografische Elemente in ihre Geschichten einfließen lassen, sind sie nicht automatisch die Erzähler der Geschichte. Der Erzähler ist die Stimme, die der Leser im Kopf hört, wenn er die Geschichte liest. Es kann sich dabei um eine Figur aus der Geschichte handeln oder um ein körperloses Wesen, das aus dem Off zum Leser spricht.
Für eine Geschichte stehen dem Autor verschiedene Erzähler zu Verfügung, die, je nach Intention des Textes, unterschiedliche Aufgaben erfüllen. Es gibt den Ich-Erzähler, den personalen, den auktorialen und den neutralen Erzähler. Diese Gruppen lassen sich nochmals unterteilen und in den verschiedenen Geschichten unterschiedlich einsetzen. So bekommt jede Geschichte, manchmal sogar jedes Kapitel, eine ganz eigene Stimme, die den Leser einfängt und ihn in eine unbekannte Welt entführt. Und genau das soll der Erzähler: Er schlägt die Brücke zwischen dem Leser und den Figuren bzw. der Handlung in der Geschichte. Er erzeugt Nähe, aber auch Distanz. Mit dem Erzähler kann man als Autor also ganz bewusst steuern, wie nah der Leser den Figuren kommen soll.
1. Der Ich-Erzähler
Der Ich-Erzähler ist selbst Gegenstand der Geschichte und berichtet hautnah über alles, was vor sich geht. Wenn der Ich-Erzähler durch die Hauptfigur verkörpert wird, kann er dem Leser eine sehr intensive Innensicht der eigenen Person bieten, denn er weiß am besten, was er mag, was ihn beschäftig und wie es in ihm aussieht. Der Ich-Erzähler kann aber auch die Rolle des Beobachters oder Chronisten einnehmen, dies geschieht meist durch eine Nebenfigur.
Egal ob er eine Haupt- oder Nebenfigur ist, der Ich-Erzähler kann nicht über seinen Tellerrand hinausschauen. Er weiß nur so viel, wie er selbst sieht, was er erlebt und empfindet. Er kann weder in die Zukunft schauen, noch Vorausdeutungen machen oder wissen, was in anderen vorgeht. Dies solltet ihr beim Verfassen einer Geschichte in dieser Erzählperspektive also unbedingt beachten. Ein weiteres Merkmal des Ich-Erzählers ist seine ihm eigene Stimme. Die Wortwahl und der Tonfall müssen dem Ich-Erzähler voll und ganz entsprechen. Ist der Ich-Erzähler beispielsweise ein Kind, muss auch seine Stimme der eines Kindes entsprechen.
Eine Sonderform des Ich-Erzählers, in der einige der soeben beschriebenen Merkmale ausgehebelt werden, stellt das erzählende Ich dar. Es erzählt die Geschichte rückwirkend und ist allwissend in Bezug auf die Geschehnisse. In diesem Fall weist der Ich-Erzähler automatisch auch auktoriale Merkmale auf, die er sonst nicht besitzt.
Da der Ich-Erzähler einen eigenen Platz innerhalb der fiktiven Welt einnimmt und emotional eingebunden ist, eignet er sich besonders für Geschichten, in der die Hauptfigur innere Kämpfe austrägt. Wenn man verschiedene Ich-Erzähler innerhalb einer Geschichte verwendet, dann spricht man von der Multiperspektive. Hier kann die Situation entstehen, dass jeder Ich-Erzähler eine andere Variante der Geschichte erzählt und der Leser für sich entscheiden muss, welcher Version er Glauben schenkt. Um den Leser nicht zu verwirren, sollte man jedoch darauf achten, dass man den Wechsel zwischen den Ich-Erzählern deutlich macht, indem man beispielsweise über den Anfang des Kapitels den Namen des jeweiligen Erzählers schreibt.
Beliebte Textformen, in denen der Ich-Erzähler verwendet wird, sind vor allem Briefromane und Bücher in Tagebuchform.
2. Der personale Erzähler
Der personale Erzähler schlüpft in die Rolle einer oder mehrerer Figuren und erzählt die Geschichte aus deren Perspektive. Dies geschieht jedoch nicht in der Ich-Form, sondern in der 3. Person. Dennoch kann der personale Erzähler nur mit den Augen der gewählten Figur in die fiktionale Welt blicken. Der personale Erzähler sieht nicht mehr, hört nicht mehr, schmeckt nicht mehr und weiß nicht mehr als diese Figur. Alles Weitere sind Vermutungen, die diese Figur anstellt. Der Leser kann nicht von vornherein wissen, ob die Wahrnehmung der Figur nicht zum Beispiel durch eine Krankheit gestört ist. Als Leser muss man sich also immer fragen, ob das, was man durch den personalen Erzähler vermittelt bekommt, auch der Wahrheit entspricht.
Um Monotonie zu vermeiden, kann man auch hier die Multiperspektive einsetzen. Dabei berichtet der personale Erzähler aus der Sicht mehrere Figuren, wodurch der Leser die Geschichte aus verschiedenen Blickwinkeln erzählt bekommt. Einer der Vorteile davon ist, dass man die Schauplätze leicht wechseln und unterschiedliche Meinungen gegenüberstellen kann. Man sollte jedoch darauf achten, den Wechsel zur nächsten Figur deutlich zu machen, so wie ich es auch schon bei der Multiperspektive des Ich-Erzählers erwähnt habe.
Der personale Erzähler eignet sich besonders für Geschichten, in denen die Handlung im Vordergrund steht und die sprachliche Gestaltung nicht so ausschlaggebend ist. Denn der personale Erzähler hält sich unauffällig im Hintergrund und lenkt nicht zu sehr von der Handlung ab.
3. Der auktoriale Erzähler
Der auktoriale Erzähler wird auch als allwissender Erzähler bezeichnet. Denn er weiß im Gegensatz zum Ich- und personalen Erzähler alles. Er kann in alle Figuren hineinblicken, kennt die Vergangenheit und Zukunft und kann dementsprechend Vorausdeutungen machen und Zusammenhänge erkennen, und diese dem Leser mitteilen. Er ist nicht Teil der Geschichte, sondern betrachtet das Geschehen von außen. Diese Perspektive gewährt euch als Autoren die größtmögliche Freiheit beim Schreiben. Allerdings schafft der allwissende Erzähler auch eine große Distanz zwischen dem Leser und den Figuren, denn er schaut mit dem Leser gemeinsam auf die Geschehnisse und die Figuren in der fiktiven Welt hinab. Dadurch identifiziert sich der Leser nicht so stark mit den Figuren, wie es bei anderen Erzählperspektiven der Fall ist. Um wieder etwas mehr Nähe aufzubauen, kann man vermehrt Szenen einstreuen, in denen die Figuren als Handelnde und Sprechende auftreten.
Die auktoriale Erzählperspektive eignet sich vor allem für Geschichten, in denen viele Figuren vorkommen und viel Stoff verarbeitet wird. Auch wenn einem diese Erzählperspektive große Freiheiten beim Schreiben gewährt, sollte man die Arbeit nicht unterschätzen, die dazu nötig ist, denn es ist gar nicht so einfach, sich allen Figuren und Schauplätzen gleichermaßen zu widmen. Manchmal kann eine Begrenzung also auch ein Segen sein.
4. Der neutrale Erzähler
Der neutrale oder auch objektive Erzähler beschreibt, was äußerlich wahrnehmbar ist. Er ist nicht nur unsichtbar, sondern verschmilzt geradezu mit dem Erzählten. Er ist wie eine Kamera, die das Geschehen aufnimmt, ohne zu kommentieren oder gar die Perspektive einer oder mehrerer Figuren einzunehmen. Er gibt die Fakten wieder und erzählt, was gesagt oder getan worden ist.
Der objektive Erzähler kennt also weder die Gedanken der Figuren, noch weiß er, was in ihnen vorgeht oder was sie empfinden. Deshalb muss der Autor dem Leser alle Informationen über den Hintergrund, den Konflikt, die Charaktere und deren Empfindungen durch Dialoge und durch die Handlung vermitteln. Der neutrale Erzähler bietet jedoch den Vorteil, dass die Geschichte sehr glaubhaft wirkt und schockierende Dinge noch wirkungsvoller sind, wenn sie kühl und nüchtern geschildert werden. Der Nachteil besteht aber darin, dass sich der Leser schlechter in die Figuren hineinversetzen und nicht so gut mit ihnen mitfühlen kann. Außerdem kann die neutrale Erzählweise bei längeren Geschichten anstrengend sein. Der objektive bzw. neutrale Erzähler eignet sich also vor allem für kürzere Werke, die besonders glaubhaft erscheinen sollen.
Sonderformen: Zweite-Person-Perspektive und Rollenprosa
Die Zweite-Person-Perspektive und die Rollenprosa sind zwei besondere Erzählformen, die es zwar gibt, aber nicht allzu häufig vorkommen.
Die Zweite-Person-Perspektive wird auch als Du-Perspektive bezeichnet, in welcher der Erzähler dem Du schildert, was es getan hat, so als ob man etwas rekapituliert oder jemandem etwas vorhält. Er spricht den Leser direkt an, wodurch dieser sich als Teil der Geschichte fühlt. Die Du-Perspektive kann auf die Dauer jedoch sehr anstrengend sein und den Leser nerven, weshalb man sich als Autor genau überlegen sollte, ob man diese Perspektive wirklich verwenden möchte.
Die Rollenprosa ist eine Sonderform der Ich-Erzählperspektive. Hier stehen die Persönlichkeit, die Tätigkeit und auch das Milieu des Ich-Erzählers im Mittelpunkt und werden vor allem durch die Sprache ausgedrückt. Der Ich-Erzähler muss hier also besonders stark sein und eine individuelle Sprache haben, die seine Persönlichkeit spiegelt. Da aus dem Kopf des Ich-Erzählers heraus erzählt wird, haben solche Geschichten meist den Klang eines Monologes bzw. einer mündlichen Erzählung.
Die richtige Perspektive wählen
Um herauszufinden, welche Erzählperspektive für eure Geschichte passt, solltet ihr euch zunächst fragen, worum es in eurer Geschichte geht. Steht eher die Handlung oder doch die Entwicklung der Figur im Mittelpunkt? Wer ist die Hauptfigur und wer sind die Nebenfiguren? Wie sind die Figuren beschaffen?
Bei handlungsorientierten Geschichten eignen sich der personale und der auktoriale Erzähler. Steht jedoch eine Figur und deren persönliche Entwicklung im Mittelpunkt, ist eventuell ein Ich-Erzähler die bessere Wahl. Bei der Darstellung unterschiedlicher Facetten, die sich nicht in einer Figur vereinen lassen, ist die Multiperspektive sinnvoll.
Dies sind jedoch nur Ratschläge, denn jede Geschichte ist individuell und kann nicht in eine Schublade gepackt werden. Wenn ihr jedoch feststellt, dass eine Geschichte nicht zu funktionieren scheint oder ihr nicht weiterkommt, kann es hilfreich sein, eine andere Erzählperspektive auszuwählen. Denn auch wenn es viel Arbeit macht, eine Geschichte komplett neu zu schreiben, lösen sich damit oft viele Probleme.
Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Experimentieren mit den unterschiedlichen Erzählperspektiven und hoffe, ihr könnt damit noch mehr aus euren Geschichten herausholen.
Eure Verena