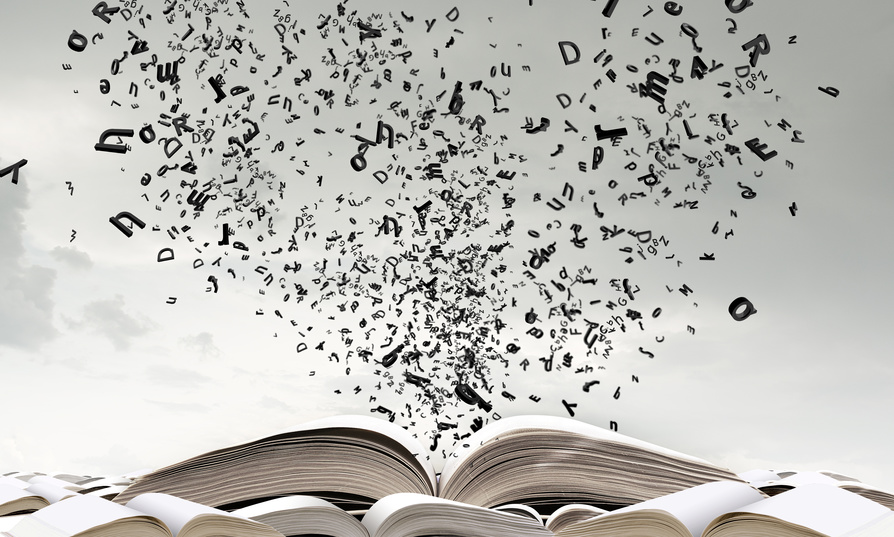Kurze – und ich meine wirklich kurze – Texte schreiben zu können, ist für Autoren essenziell. Denn, wer kurze Texte verfassen kann, der schafft es auch, den Blick auf dem Wesentlichen zu behalten und in seinen Geschichten nicht abzuschweifen.
Beim Schreiben von kurzen Texten könnt ihr üben, wie ihr dem Leser den Charakter einer Figur in wenigen Sätzen zeigt, wie ihr das Setting oder die Atmosphäre möglichst knapp beschreibt oder wie ihr eine überraschende Wendung einbaut. Deshalb zeige ich euch heute, welche kurzen Textsorten es gibt.
Eine besondere Form solcher Minitexte stellt die Kürzestgeschichte dar. Es gibt keine Definition, wie viele Wörter oder Zeichen eine Kürzestgeschichte haben darf, aber sie weist im Wesentlichen folgende Merkmale auf:
1. Sie kommt sehr schnell zum Kern der Geschichte und verzichtet auf eine Einleitung.
2. Sie ist in sich geschlossen und es gibt in der Regel kein Vorher und kein Nachher.
3. Hinsichtlich ihrer Themen gibt es keine Beschränkung – alles ist erlaubt
4. Jedes überflüssige Wort ist zu streichen. Dies gilt vor allem für Blähwörter, unbeabsichtigte Wiederholungen oder Dopplungen. Die Wortwahl ist so präzise wie möglich.
5. Die Sprache ist meist reich an Metaphern und Symbolen.
6. Die Figuren zeigen keine oder nur eine geringe Entwicklung. Oft wird nur ein Charakterzug dargestellt.
7. Es gibt kaum Handlung. Eine Kürzestgeschichte zeigt meist nur einen Augenblick oder eine Situation.
8. Sie steuert auf eine überraschende Wendung oder Pointe zu.
Damit ihr seht, was genau man darunter versteht, habe ich hier zwei meiner Kürzestgeschichten für euch:
Der Weg war steinig
Der Weg war steinig und unwegsam. An den Seiten wurde er gesäumt von Feldern aus Raps und Getreide, doch kein Bauer war zu sehen. Es war totenstill, nur das Pfeifen des Windes war zu hören. In der Ferne stieg Rauch in die Höhe und schon bald konnte ich Häuser sehen. Es waren einfache Häuser, die von einfachen Leuten bewohnt wurden. Ich klopfte an das erste Haus, dessen Vorhänge den Blick durch die Fenster nicht gänzlich versperrten. Ich war lange unterwegs und hatte Hunger. Die Bauersfrau gab mir zu essen und führte mich in den Keller, in dem ein Bett für mich bereitstand. Da ich hundemüde war, schlief ich sofort ein, doch nachts riss mich ein lauter Knall aus den Träumen. Sirenen ertönten, Rauch breitete sich aus. Der Krieg hatte mich gefunden.
713 Freunde
Er hat 713 Freunde. Er ist stolz, denn soeben hat er einen neuen Freund hinzugefügt. Nun sind es 714. Zum Mittag hatte er eine Currywurst. 320 seiner Freunde haben sein Foto geliked. 2 fanden es sogar so gut, dass sie es geteilt haben. Er ist stolz. Susi hat sogar einen Kommentar geschrieben: „Lecker.“
Seit längerem schon will er sie nach einem Date fragen, doch ihr Beziehungsstatus lautete bisher immer „in einer Beziehung“. Jetzt steht dort „Single“. Er wagt es und schreibt ihr eine PM. Sie antwortet nicht. Er hat 713 Freunde. Susi gehört nicht mehr dazu. Sie hat die Freundschaft beendet. Einfach so, mit einem Tastendruck.
Andere Minitexte, die sich auch super für Schreibübungen eignen, sind literarische Schnappschüsse, auch Snapshots genannt, und Webcam-Texte.
Literarische Schnappschüsse sind Momentaufnahmen, die aus nur einem einzigen Satz bestehen. Außerdem besitzt der Satz kein Prädikat (Satzaussage, die mit einem Verb gebildet wird) und auch keine Wertung. Der Schnappschuss ist so neutral wie die Aufnahme mit einer Fotokamera. Ein Webcam-Text hingegen geht noch etwas weiter. Hierbei wird eine Alltagsszene beschrieben, und zwar so neutral wie möglich. Der Text wird im Präsens geschrieben und enthält ebenfalls keine Wertungen.
Selbstverständlich müsst ihr euch bei euren Übungen nicht penibel an die eben genannten Eigenschaften der Snapshots oder Webcam-Texte halten. Ich persönlich mag es, Momentaufnahmen zu schreiben, die, ich gebe es zu, oft ein Prädikat enthalten. Oft versuche ich auch, meine längeren Geschichten in einem einzigen Satz zusammenzufassen. Denn diese Übung hilft enorm, wenn es irgendwann einmal darum geht, den eigenen Roman für den Pitch im Exposé in einem bis drei Sätzen zusammenzufassen.
Für Webcam-Texte könnt ihr zudem durch die Beobachtung eurer Umgebung, egal ob es sich dabei um eure Mitmenschen oder die Natur handelt, Details wahrnehmen, die ihr euch niemals ausdenken könntet. Je mehr dieser Beobachtungen ihr aufschreibt, desto leichter fällt es euch später, in euren literarischen Texten ähnliche Situationen zu beschreiben. Deshalb solltet ihr ab sofort immer ein Notizbuch und einen Stift dabei haben …
Probiert es doch mal aus und berichtet mir davon!
Eure Verena