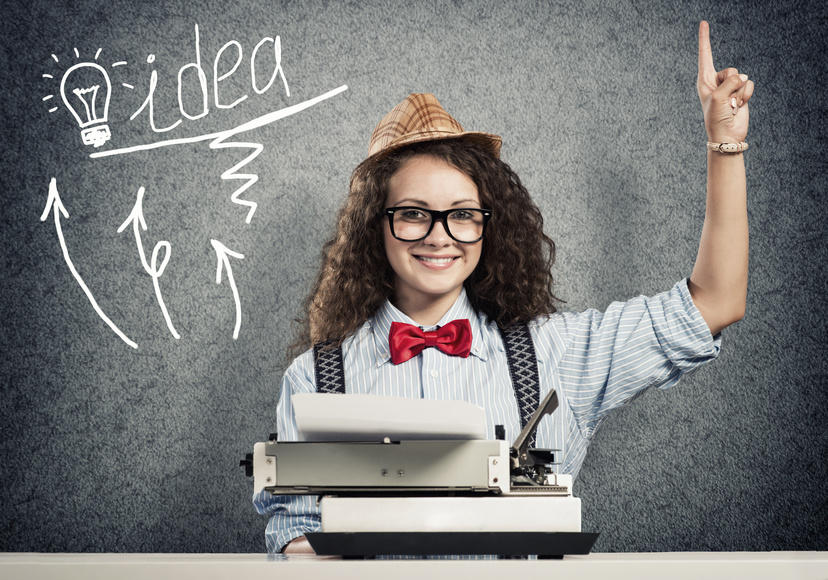Wenn ich an spannende Literatur denke, fallen mir zuerst Krimis, Thriller und Horrorgeschichten ein. Doch nicht nur in diesen, sondern auch in allen anderen Genres braucht es Spannung, um das Interesse der Leser nicht zu verlieren. Ob Komödie, Liebesroman oder kurze Erzählung: Ohne Spannung kommt keine Geschichte aus.
Spannung zeigt sich in den unterschiedlichsten Kleidern: Mal macht sie uns neugierig darauf, wie es weitergeht, dann können wir das Buch nicht mehr aus der Hand legen, oder sie lässt unsere Hände schwitzen und unser Herz bis zum Hals schlagen. Um dies bei einem Leser zu bewirken, müssen verschiedene Voraussetzungen erfüllt sein. Hierfür gibt es unterschiedliche Methoden, die ihr anwenden könnt und davon möchte ich euch in diesem Blogpost berichten.
Eine Grundvoraussetzung, damit Spannung entstehen kann, ist, dass die Leser verstehen müssen, worum es in eurer Geschichte geht, was das Ziel ist, das in der Geschichte erreicht werden soll. Nur so kann der Leser auch die Umstände nachvollziehen, die es dem Helden auf seinem Weg so schwer machen – und dies erzeugt Spannung.
Eine weitere Voraussetzung, um Spannung zu erzeugen, ist, beim Leser Sympathie bzw. Interesse für die Figuren zu wecken. Das bedeutet, dass ihr eure Helden erst in brenzlige Situationen bringen solltet, nachdem ihr sie ausführlich genug eingeführt habt. Mit »ausführlich« meine ich nicht, dass der Leser die gesamte Lebensgeschichte der Figuren kennen muss. Er sollte sie jedoch so weit kennen, dass er sich ihnen nahe fühlt und Mitleid verspürt, wenn ihnen etwas passiert.
Neben den Voraussetzungen gibt es verschiedene Techniken, die ihr als Autor anwenden könnt, um Spannung aufzubauen und während des Handlungsverlaufes hochzuhalten.
Eine dieser Methoden besteht darin, Geheimnisse in die Geschichte einzubauen. Hier muss jedoch zwischen zwei Arten unterschieden werden: offene und verdeckte Geheimnisse.
Offene Geheimnisse
Bei den offenen Geheimnissen ist dem Leser in der Regel klar, worum es geht, er ist ein Mitwisser. Der Protagonisten wiederum kann entweder selbst der Geheimnisträger sein und versuchen, es nicht auffliegen zu lassen, oder im Dunkeln tappen und ständig kurz davor sein, das Geheimnis zu lüften. In beiden Fällen wird beim Leser die Spannung hochgehalten, indem er miterlebt, wie die Figur versucht, das Geheimnis zu wahren oder es zu lüften. Der Leser hat in jedem Fall einen Informationsvorsprung und wird emotional an der Geschichte beteiligt.
Verdeckte Geheimnisse
Bei den verdeckten Geheimnissen wissen der Leser und der Protagonist gleich viel – nämlich nichts. Dieses Mittel wird zumeist in Krimis eingesetzt, beispielsweise wenn es darum geht, einen Mörder zu finden. Doch auch in anderen Genres lohnt es sich, verdeckte Geheimnisse einfließen zu lassen und diese nach und nach aufzulösen. Da sich der Leser in der Regel seine eigenen Gedanken zu den Rätseln und Geheimnissen macht, kann man den Leser mit der Auflösung in kleinen »Häppchen« entweder in seiner Annahme bestätigen oder ihn komplett überraschen, indem man unerwartete Lösungen bringt. Egal, für welche Art man sich entscheidet, mit dem Lüften von Teilgeheimnissen wird der Leser unweigerlich bei der Stange gehalten, da er wissen wollen wird, wie es weitergeht.
Eine weitere Möglichkeit, um Spannung hochzuhalten, besteht darin, besonders stark auf die Emotionen der Leser zu zielen. Themen, die in besonderem Maße unser Mitgefühl und unsere Anteilnahme herausfordern und uns berühren, sind: Schmerzen, Leiden, Tod, Gewalt, Leidenschaft, Sexualität, Liebe und Kinder. Die Liste kann selbstverständlich beliebig erweitert werden.
Auch die Geschwindigkeit kann spannungssteigernd wirken, denn das Aufeinanderfolgen vieler Ereignisse kurz hintereinander lässt die Figuren nicht zur Ruhe kommen und zwingt den Leser, immer weiter zu lesen, um den Ausgang der Geschehnisse zu erfahren. Um das Tempo hochzuhalten, eignen sich außerdem kurze Sätze und Kapitel sowie schnelle und harte Szenenwechsel.
Für noch mehr Spannung sorgen auch Normbrüche, ungewöhnliche oder bizarre Elemente, Andeutungen, versteckte Hinweise und falsche Fährten. Durch das Abweichen von der Norm werden die Erwartungen der Leser unterlaufen, da sich die Geschehnisse anders entwickeln als gedacht, und dies sorgt für eine gehörige Portion Spannung. Mit Andeutungen könnt ihr zudem auf Kommendes hinweisen oder sogar falsche Fährten legen. Wichtig ist nur, das richtige Maß zu halten, denn zu viel zu verraten, verursacht Langeweile, und zu wenig preiszugeben, kann den Leser verwirren.
Ich hoffe, meine Tipps konnten euch weiterhelfen. Um auch bei euch ein wenig die Spannung hochzuhalten, kann ich euch jetzt schon verraten, dass das zu diesem Thema natürlich noch nicht alles gewesen ist. Nun wünsche ich euch jedoch erst einmal viel Spaß beim Entwickeln spannender Geschichten!
Eure Verena