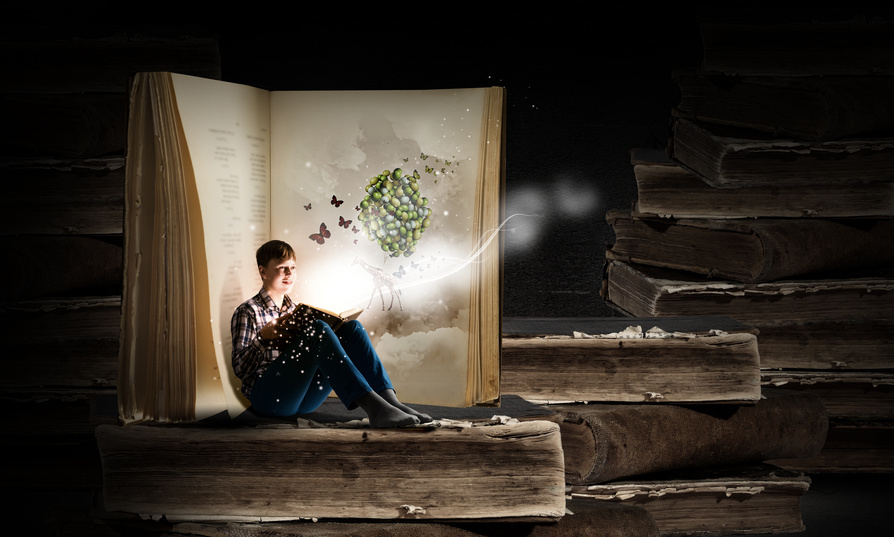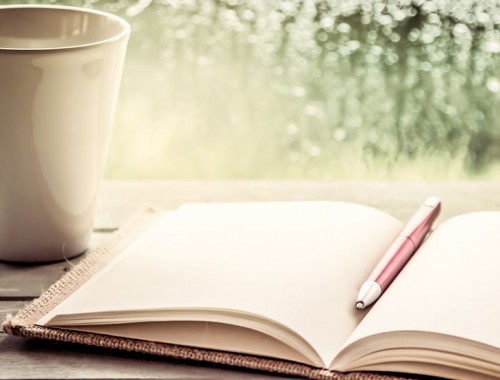Metaphern sind so etwas wie magische Schlüssel in der Literatur. Sie öffnen die Pforten zu neuen Welten, bieten den Lesern Einblicke in Mysterien, bringen sie zum Staunen und zum Lachen und lassen sie alles um sich herum vergessen.
Um Klischees und veraltete sprachliche Bilder zu vermeiden, habe ich euch hier einige Methoden zur Metaphernbildung und Hinweise für ihren Gebrauch zusammengestellt. Damit könnt ihr euch ganz einfach eure eigenen Metaphern erschaffen.
1. Die Verwendung von Metaphern
Eine Metapher ist ein sprachliches Bild, sie ist nicht wörtlich zu verstehen und verknüpft ein Bild mit etwas anderem auf eine Weise, die wörtlich genommen unmöglich ist. Dadurch lässt sich mit einer Metapher auf engstem Raum viel mehr sagen, als es mit der konventionellen Sprache möglich wäre. Außerdem werden die Sinne der Leser angesprochen, da Metaphern mit Sinneseindrücken arbeiten. Sie beziehen den Leser mit ein, denn er muss die Bilder verstehen und interpretieren.
Doch Vorsicht, zu viele Metaphern in einem Text hemmen seine Lesbarkeit. Wenn der Leser permanent damit beschäftigt ist, sich die Bilder vorzustellen und sie in einen Zusammenhang zu bringen, dann kann er sich nicht mehr auf die Handlung konzentrieren. Deshalb lautet mein erster Tipp: Weniger ist mehr!
Bei der Auswahl der Metaphern sollte man sich zudem vor Klischees hüten, also vor toten Bildern, die früher einmal originell waren. Sie wurden so häufig genutzt, dass sie in unseren Sprachgebrauch eingegangen sind und deshalb langweilig wirken. Ein Beispiel hierfür wäre: »Im Geld schwimmen.« Dieses Bild ist uns so vertraut, dass es keine starke Aussagekraft mehr hat. Viel besser ist es, eigene Bilder zu entwickeln. Und das schauen wir uns jetzt an.
2. Metaphernbildung
Wenn man eine Textstelle mit einem sprachlichen Bild aufwerten möchte, geht dies am besten, indem man eigene Metaphern erschafft. Die einfachste Methode, um Metaphern zu entwickeln, ist der sogenannte Metaphernbaukasten. Hierfür legt man eine Liste an und sammelt auf der einen Seite aussagekräftige Attribute (wie ist etwas) und auf der anderen Seite Subjekte. Wenn man eine Metapher für eine ganz bestimmte Situation sucht, dann sammelt man am besten Attribute und Subjekte, die gezielt dazu passen. Beispiele hierfür sind:
Attribute (Bildspender): vollgetankt, abgewrackt, verdorrt, hirnverbrannt …
Subjekte (Bildempfänger): Mensch, Vertrauen, Freundschaft, Blick, Schweigen …
Danach mischt man die Attribute und Subjekte und schaut, welche Konstellation am besten zur Situation passt, die man beschreiben möchte, und schon hat man sein eigenes sprachliches Bild erschaffen.
3. Andere sprachliche Bilder
Die Bildung einer Analogie bietet eine weitere Möglichkeit, Metaphern zu erschaffen. In einer Analogie werden zwei sich ähnelnde Dinge zusammengefügt. Diese Ähnlichkeit muss entweder in der Form, der Beschaffenheit oder der Funktionsweise liegen. Ein Beispiel hierfür ist: »Deine Augen sind Sonnen.« Hier liegt die Ähnlichkeit in der Funktionsweise. Auge und Sonne können beide »strahlen«. Es gibt unzählige Analogien, die man so finden kann.
Auch Symbole sind in der Literatur kaum wegzudenken. Ein Symbol ist ein konkretes Sinnbild, das über sich hinausweist und eine allgemeine Bedeutung besitzt, die von vielen Menschen verstanden wird. Beispielsweise wird der Ehering als Symbol der Liebe betrachtet und ein Rabe als Symbol für den Tod.
Es gibt jedoch auch Symbole, die der Leser nicht sofort versteht, die er also erst mit Deutungen und Assoziationen füllen muss. Ein Beispiel hierfür ist die zusammengewürfelte Schiffsmannschaft in Herman Melvilles Roman »Moby Dick«, welche die gesamte menschliche Gesellschaft repräsentiert.
Habt ihr auch schon einmal eigene Metaphern für eure Geschichten erschaffen? Schreibt mir doch hierzu eine Nachricht! Ich freue mich, von euch zu hören.
Eure Verena